Leben bis ans Ende
11.10.2025

© Adobe Stock
Palliative Care beginnt bereits mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit – nicht erst in den letzten Lebenstagen. Manche Krankheiten entwickeln sich schleichend über Jahre, andere Diagnosen reissen Betroffene plötzlich aus ihrem Alltag. Nichts ist mehr wie zuvor. Oft wird Palliative Care fälschlicherweise mit Sterbebegleitung gleichgesetzt. Tatsächlich umfasst sie eine ganzheitliche Betreuung: Ein interprofessionelles Team begleitet die Patient*innen und bezieht Angehörige und Freundeskreis ein.
Leben mit der Krankheit
Viele Menschen mit unheilbaren Erkrankungen können noch lange aktiv am Leben teilnehmen. Doch Symptome, Schmerzen und Einschränkungen erfordern neue Wege des Umgangs. Gemeinsam mit den Patient*innen wird nach individuellen Lösungen gesucht, um die Lebensqualität zu erhalten und vorhandene Ressourcen zu stärken.

© Pexels/Marian Strinoiu
Wenn das Alte nicht mehr trägt
Die Diagnose einer unheilbaren Krankheit beeinflusst alle Lebensbereiche. Wenn Bewegungen nicht mehr möglich sind, wenn chronische Schmerzen den Alltag bestimmen oder wenn bisherige Fähigkeiten verloren gehen, fordert das eine neue Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Erwartungen. Besonders schwierig ist es, wenn persönliche Vorstellungen und Realität weit auseinanderliegen.
Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Palliative Care, fasste es so zusammen:
"Es geht am Ende des Lebens nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben."
Orientierung am Guten
Menschen mit unheilbaren Krankheiten lernen, was ihnen guttut und wie sie sich selbst helfen können. Ein wichtiger Schritt ist, den Blick auf das zu richten, was weiterhin möglich ist – und diese Dinge neu zu schätzen. Das salutogenetische Modell (1) verdeutlicht: Gesundheit ist kein fixer Zustand. Wir bewegen uns immer auf einem Spektrum, das von vielen Faktoren beeinflusst wird – körperlich, seelisch und sozial.
Cicely Saunders entwickelte ein mehrdimensionales und ganzheitliches Schmerzkonzept, das körperliche, seelische, soziale und spirituelle Dimensionen einbezieht. Schmerzen können auf all diesen Ebenen entstehen – und ebenso können dieselben Ebenen als Quelle von Kraft und Trost erfahren werden.
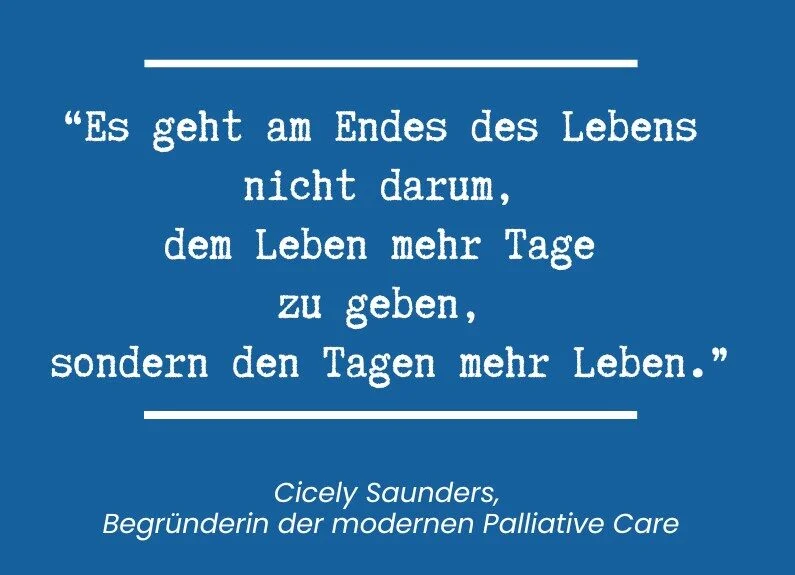
Lernen für alle Lebensphasen
Die Erfahrungen aus der Palliative Care bieten auch wertvolle Impulse für die Behandlung heilbarer Krankheiten und für Prävention. Eine gute Selbstwahrnehmung hilft, Bedürfnisse zu erkennen und Behandlungen besser abzustimmen. Es lohnt sich, diese Fähigkeit zu stärken, bevor Symptome uns daran hindern.

© Adobe Stock
Begleitung durch KomplementärTherapie
Komplementärtherapeutische Methoden fördern Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse klar zu benennen. Ob gesund, unheilbar oder akut erkrankt – es ist sinnvoll, sich frühzeitig einen „Blumenstrauss“ an inneren und äusseren Ressourcen bereitzuhalten, auf den man im Bedarfsfall zurückgreifen kann.
Die Informationen zur Palliative Care stammen aus einem Gespräch mit Dr. med. Daniela Zimmermann, FMH Allgemeine Innere Medizin, CAS Palliative Care.
Autor:
Mario Schenker, KomplementärTherapeut mit Branchenzertifikat Methode AlexanderTechnik, Baden
Mitglied beim Schweizerischen Berufsverband der AlexanderTechnik SBAT, www.alexandertechnik.ch
(1) Salutogenese nach Aaron Antonovsky: Resilienz-Modell, das die kognitiven Bewältigungsstrategien zur Abwendung von Gesundheitsrisiken betont. (https://flexikon.doccheck.com/de/Salutogenese, 18.9.25)
Beitrag teilen